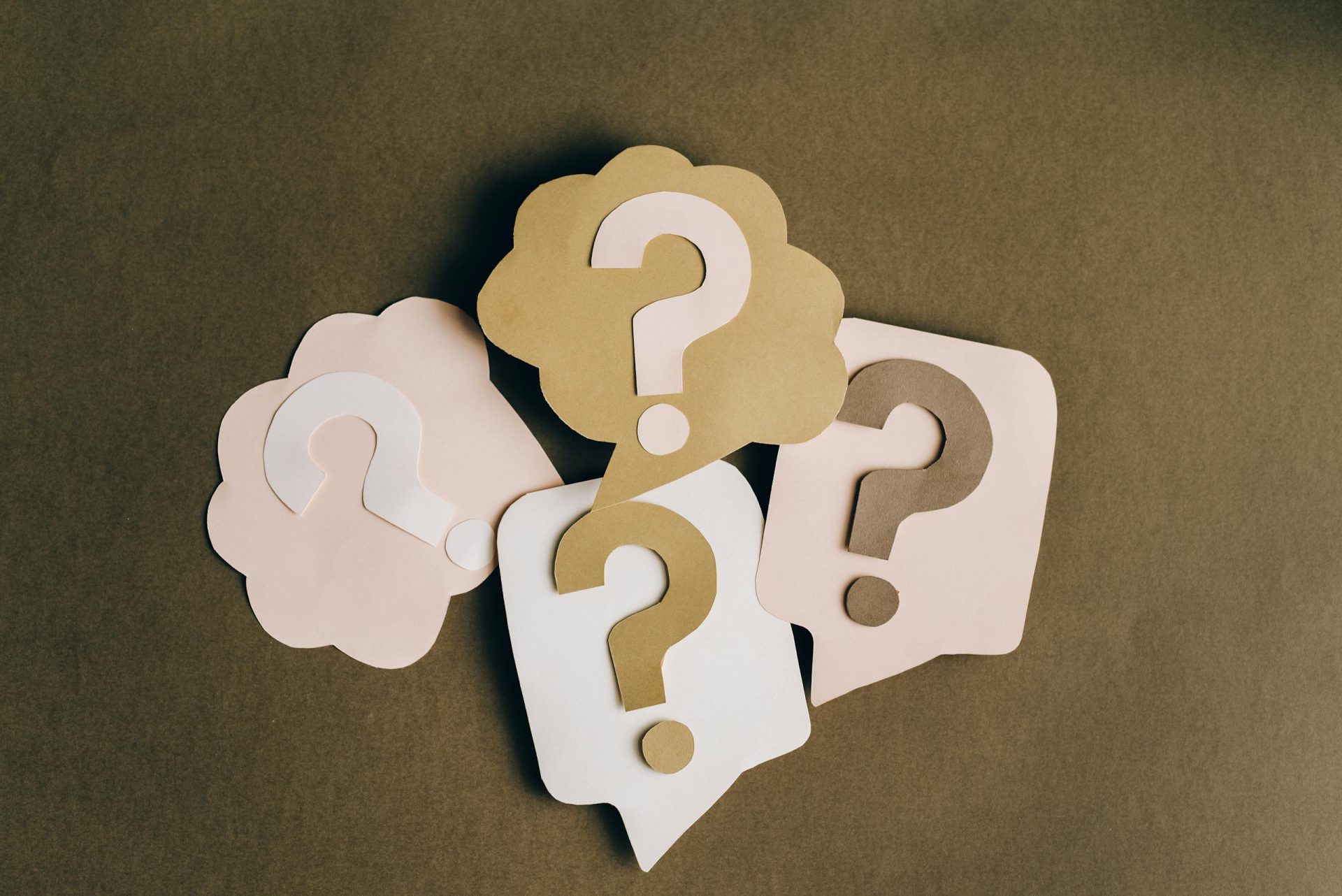Philosophie – Was ist das eigentlich?
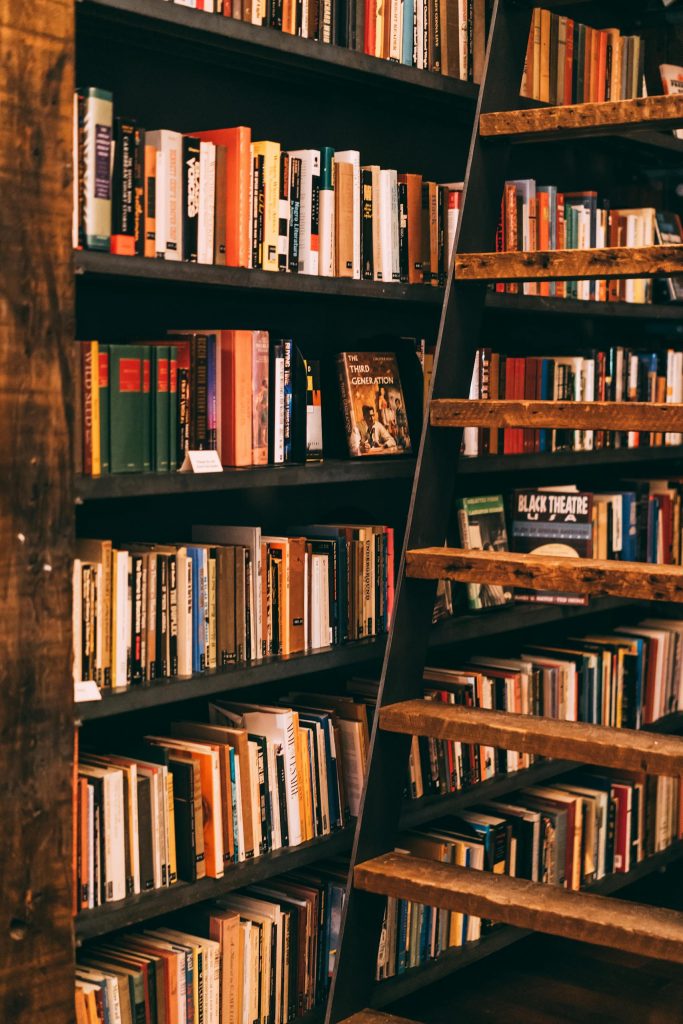
Philosophieren heißt Fragen stellen.
Man kann nicht Philosophie lernen. Man kann nur lernen, zu philosophieren.
Philosophie ist die Liebe zur Wahrheit.
Philosophieren lernen, heißt Denken lernen.
Tatsächlich füllt die Frage, was Philosophie ist, ganze Bücherregale. Philosoph:innen streiten sich seit der Antike darüber. Hier, wie auch sonst in der Philosophie, gibt es keine kurze und knackige Antwort. Ich kann hier zumindest einen kleinen Einblick geben, was Philosophie als Unterrichtsfach in der Schule ist. Im Fokus stehen im Unterricht immer Probleme und Fragen, die ergebnisoffen diskutiert werden – mit Zuhilfenahme von Literatur, aber auch Filmen, Podcasts, Musik und anderen Medien.
In der Einführungsphase (Klasse 10) lernst du die Grundlagen philosophischen
Argumentierens kennen. Auf der Basis von aktuellen ethischen und philosophischen
Fragestellungen lernst du Schritt für Schritt, mit anspruchsvollen philosophischen Texten umzugehen und selbst überzeugend Stellung zu ihnen zu nehmen. Im Vordergrund steht dabei die Förderung der Argumentations- und Urteilskompetenz. Diese schulst du durch Übungen zur Texterschließung und argumentativer sowie kreativer Textproduktion. Auch mündliche Methoden wie Rollenspiele und Debatten kommen zum Einsatz. Des Weiteren arbeitest du mit Philosophie in Film, Musik und Literatur.
Der deutsche Philosoph Immanuel Kant hat sein Lebenswerk den vier großen philosophischen Fragen gewidmet: Was soll ich tun? Was ist der Mensch? Was kann ich wissen? Was darf ich hoffen?
In der Qualifikationsphase (Sekundarstufe II) wirst du dich pro Halbjahr mit jeweils einer dieser Fragen ganz intensiv auseinandersetzen. Aus jeder großen Frage ergeben sich viele konkrete Fragen, die du im Unterricht verstehen, bearbeiten, diskutieren und für dich ganz persönlich beantworten wirst. Philosoph:innen von der Antike bis heute stehen dir bei der Findung von Antworten als „Expert:innen“ zur Seite. Im Philosophieunterricht lernst du, ihre Positionen nachzuvollziehen, um dir dann im nächsten Schritt ein begründetes und stichhaltiges Urteil zu bilden.
1. Kurshalbjahr: Werte und Normen – „Was soll ich tun?“
Mögliche Fragestellungen könnten sein:
Gibt es einen gerechten Krieg? (politische Philosophie)
Dürfen wir Tiere essen? (praktische Philosophie)
Dürfen wir von Terroristen entführte Flugzeuge abschießen? (praktische
Philosophie)
Dürfen wir Menschen foltern, um Verbrechen aufzuklären? (praktische
Philosophie)
2. Kurshalbjahr: Mensch und Gesellschaft: – „Was ist der Mensch?“
Mögliche Fragestellungen könnten sein:
Was macht uns Menschen aus? (Anthropologie)
Sind wir frei in unserem Handeln und Denken? (u.a. Erkenntnistheorie)
Welche Gesellschafts- und Staatsform ist die beste? (politische Philosophie)
Was ist der Sinn des Lebens? (u.a. Existentialismus)
3. Kurshalbjahr: Erkenntnis und Wahrheit – „Was kann ich wissen?“
Mögliche Fragestellungen könnten sein:
Inwieweit beeinflusst unsere Sprache unser Denken? (Sprachphilosophie)
Was ist der Unterschied zwischen Meinen, Glauben und Wissen? (Erkenntnistheorie)
Welche ethischen Konsequenzen folgen aus wissenschaftlichen Erkenntnissen?
(Wissenschaftstheorie)
Gibt es die eine Wahrheit? (Erkenntnistheorie)
4. Kurshalbjahr: Sein und Werden – Was kann ich hoffen?
Mögliche Fragestellungen könnten sein:
Gibt es einen Gott? (Religionskritik)
Kann ich Wissenschaftler sein und gleichzeitig an Gott glauben? (Religionskritik)
Wohin könnte das alles schlimmstenfalls führen? (Dystopie)
Was müssen wir tun, um die Welt zu verbessern? (Utopie)
Neugierde auf philosophische Fragen und Antworten
Freude an Diskussionen und Debatten
Lust am Lesen und Schreiben von argumentativen und kreativen Texten
Geduld und Wille, sich auch mit schwierigen philosophischen Texten und abstrakten Gedankengängen auseinanderzusetzen
Offenheit, sich auf andere Positionen einzulassen und gegebenenfalls lieb
gewonnene Meinungen über den Haufen zu werfen
Und am wichtigsten: Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen